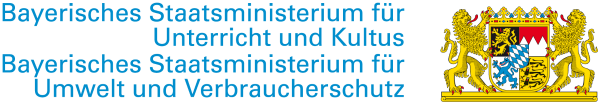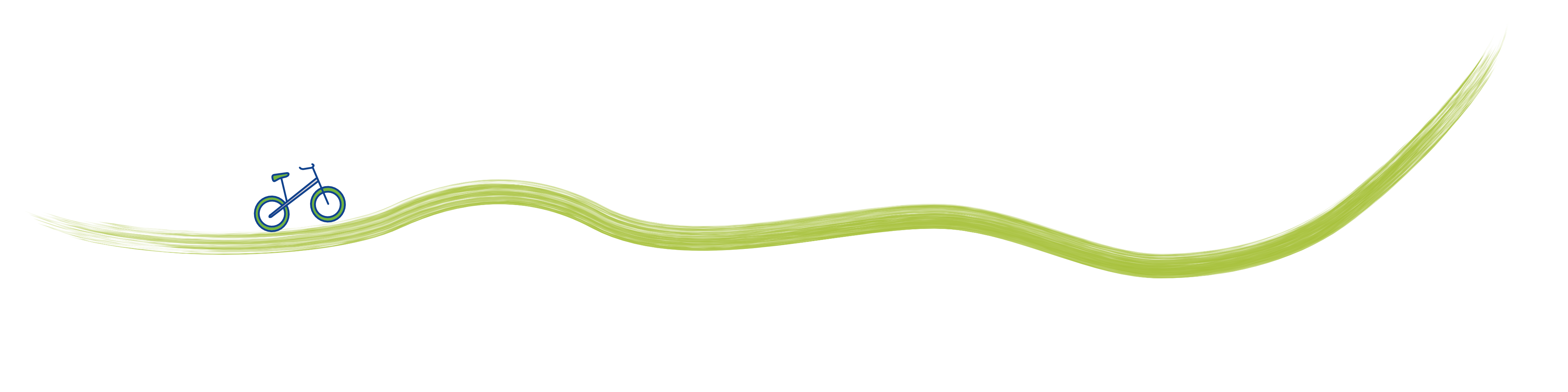Klimaschule leben - den Schulentwicklungsprozess verstetigen
Nach der erfolgreichen Erstzertifizierung ist es wichtig, den eingeschlagenen Weg mit der gleichen Systematik und Begeisterung fortzusetzen. Die folgende Abbildung veranschaulicht die damit verbundenen Aufgaben und Ziele. Eine feste Reihenfolge gibt es bei der Umsetzung der Aufgaben nicht. Vielmehr handelt es sich bei den meisten Aufgaben um dauerhafte Herausforderungen, die es systematisch und stetig in den Blick zu nehmen gilt.

Statusverlängerung erst nach drei Jahren - Höherstufung jährlich möglich
Schulentwicklungsprozesse brauchen Zeit. Eine Rezertifizierung in der gleichen Zertifizierungsstufe (Statusverlängerung) soll deshalb erst nach drei Jahren erfolgen. So können sich Schulen auf das Wesentliche Ihrer Klimaschutzarbeit konzentrieren: die Umsetzung von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen an der Schule sowie die damit verbundene Verstetigung und Vertiefung des Schulentwicklungsprozesses.
Schulen sollen aber auch zur Weiterentwicklung motiviert werden. Schulen können sich deshalb jährlich um eine höhere Zertifizierungsstufe bewerben, wenn sie die hierfür nötigen Kriterien erfüllen.
Einen Überblick über die Kriterien zur Rezertifizierung finden Sie hier oder im offiziellen Leitfaden zur Zertifizierung und Rezertifizierung in Kapitel 3 ab Seite 28.
Weitere Infos zu den Aufgaben und Zielen von Klimaschule leben

Klimaschutzmaßnahmen umsetzen
Klimaschulen handeln und sind Vorbilder im Klimaschutz. Es ist deshalb von zentraler Bedeutung, dass Klimaschulen in Phase 2 Klimaschutzmaßnahmen aktiv mit Schülerinnen und Schülern umsetzen. Die Grundlage ist hierfür der in Phase 1 erstellte Klimaschutzplan.

Stärkung der Schülerpartizipation
Klimaschulen stärken die Schülerpartizipation und versuchen diese strukturell im Schulleben zu verankern. Dies gelingt z. B. durch die Einführung eines Schülerparlaments, eines Klimarates oder durch die Ernennung von Klimabotschafterinnen und Klimabotschaftern in allen Klassen.
Dadurch werden die beteiligten Schülerinnen und Schüler aktiv in Entscheidungs- und Entwicklungsprozesse einbezogen, wie z. B. bei der Einführung eines vegetarischen Tages in der Mensa, eines nachhaltigen Fahrtenkonzepts oder bei der Einführung eines Mülltrennungssystems. Dieser Prozess stärkt wiederum die Akzeptanz und das Verständnis in der Schulgemeinschaft hinsichtlich der durchgeführten Klimaschutzmaßnahmen. Weiter übernehmen Schülerinnen und Schüler Verantwortung bei der Umsetzung dieser Aufgaben und entwickeln dabei ihre Kompetenzen und ihre Persönlichkeit weiter.

Weiterentwicklung des Klimaschutzplans
Klimaschulen entwickeln ihren Klimaschutzplan weiter, indem sie neue Maßnahmen planen, bestehende Maßnahmen ggf. ausbauen oder verstetigen und neue Handlungsfelder in den Blick nehmen.

Leuchtturmfunktion ausbauen
Klimaschulen sind sich ihrer Vorbildfunktion bewusst und strahlen durch ihr Handeln und Wirken in Gesellschaft aus. Durch eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, z. B. auf der Website der Schule, durch Elternbriefe oder durch Artikel in der in der Lokalpresse kommunizieren Klimaschule gezielt ihre Aktivitäten und verstärken dadurch ihre Vorbildfunktion. Sie unterstützen Schulen, die sich auf dem Weg zur Klimaschule befinden.
Durch die Vernetzung mit anderen Schulen oder externen Partnern im Bereich Klimaschutz wird die Vorbildfunktion weiter gestärkt.
Im Klimaschutzplan beschreiben Klimaschulen, wie sie ihre Leuchtturmfunktion erfüllen und ihre Klimaschutzarbeit kommunizieren.

Treffen des Projektteams
Regelmäßige Treffen des Projektteams Klimaschule, zu denen alle Kolleginnen und Kollegen und ggf. weitere Mitglieder der Schulfamilie eingeladen werden, sorgen dafür, dass der Schulentwicklungsprozess transparent, ganzheitlich und partizipativ gestaltet wird. Die anschließende Breitstellung eines Ergebnisprotokolls von jeder Sitzung schafft Nachvollziehbarkeit für das Kollegium. Die Einbindung der Schulleitung ins Projektteam kann diesen Prozess unterstützten.

Unterrichtsentwicklung
In Phase 2 sollte die systematische Verankerung von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbildung im Unterricht erfolgen, so dass Fachwissen im Kontext der Klimakrise gezielt vermittelt, Zusammenhänge von den Schülerinnen und Schülern erkannt, Handlungskompetenzen entwickelt und Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglicht werden. Im Klimaschutzplan beschreiben Schulen, welche Schritte auf diesem Weg bisher unternommen wurden und welche weiteren Schritte sie hierzu in Zukunft geplant sind.

Weitere Projekte und Maßnahmen zu den 17 UN-Nachhaltigkeitszielen
Zudem sollen Klimaschulen spätestens in Phase 2 damit beginnen, Nachhaltigkeitsprojekte mit Bezug zu weiteren Nachhaltigkeitszielen aus verschiedenen Themenfeldern umzusetzen, wie z. B. die Einführung von fairer Schulkleidung, die Einrichtung eines Fairtrade-Verkaufs in der Pause, die Gestaltung und Bewirtschaftung eines insektenfreundlichen Schulgartens, die Durchführung einer Podiumsdiskussion mit Lokalpolitiker/-innen zu verschiedenen Themen der Kommunalpolitik, die Ansaat einer Blumenwiese auf dem Schulgelände, den Bau von Insektenhotels u. v. m.
Auf diese Weise sollen, neben den Nachhaltigkeitszielen 4 und 13, weitere Ziele der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele aktiv unterstützen werden und verstärkt in den Blick von Schulen rücken. Dadurch wird die Schulgemeinschaft für weitere Bereiche der Nachhaltigkeitsbildung sensibilisiert und Bildung für Nachhaltige Entwicklung an der Schule gestärkt.

CO2-Fußabdruck erneuern
Im Abstand von zwei bis drei Jahren sollte außerdem der CO2-Fußabdruck der Schule erneuert werden, um die Entwicklung des schulischen CO2-Fußabdrucks und die Wirksamkeit der ergriffenen Klimaschutzmaßnahmen zu überprüfen und ggf. durch weitere Maßnahmen nachbessern zu können.

Schulgremien einbinden
Einmal jährlich sollten Klimaschulen in der Lehrerkonferenz den aktuellen Arbeits- und Planungsstand vorstellen. Für die Bewerbung um die Rezertifizierung muss zudem der aktualisierte Klimaschutzplan von den Schulgremien angenommen werden.
Letzte Änderung: 16.10.2025